Rotlicht war gestern: neue Wege der Infrarot-Therapie
Was moderne Systeme besser können. Anschaulich erklärt und wissenschaftlich fundiert.
Warum klassisches Rotlicht an Grenzen stößt
Das bekannte Rotlicht aus der Hausapotheke arbeitet mit sichtbarem roten Licht. Die Wirkung ist vor allem Wärme an der Oberfläche. Die Eindringtiefe ist begrenzt und liegt in der Regel im Bereich weniger Millimeter. Tiefer gelegene Strukturen wie Muskeln, Gelenke oder bindegewebige Schichten werden damit kaum erreicht.
- Spürbare Wärme, jedoch überwiegend an der Hautoberfläche
- Keine gezielte Ansprache tieferer Gewebeschichten
- Eher kurzfristige Entspannung statt adressierter biochemischer Prozesse
Was moderne Infrarot-Systeme anders machen
Neue Systeme kombinieren Rotlicht für die oberen Hautschichten mit Nahinfrarotlicht (NIR) für tiefere Gewebebereiche. Häufig kommt eine Impulsmodulation hinzu, die die biologische Reaktion gezielt unterstützen kann. So lassen sich Geweberegionen erreichen, die mit einfachem Rotlicht nicht sinnvoll angesprochen werden.
Wellenlängen in Kürze: NIR, MIR, LWIR
- NIR Nahinfrarot ca. 780 bis 1400 nm dringt im Vergleich zu vielen anderen Lichtarten tiefer in das Gewebe ein. Typischerweise bis zu 10 bis 15 mm. Die tatsächliche Tiefe hängt von Gewebe, Hauttyp und Anwendungsparametern ab.
- MIR Mittleres Infrarot 1400 bis 3000 nm wird stark oberflächlich vom Wasser in der Haut absorbiert. Die Wirkung ist überwiegend thermisch.
- LWIR Langwelliges Infrarot ab 3000 nm wirkt ebenfalls vor allem an der Oberfläche. Es sorgt für Wärme, erreicht jedoch keine tieferen Strukturen.
Modulation und Impulsfrequenzen
Statt Dauerausgabe mit gleicher Intensität kann Licht in Impulsen abgegeben werden. Ziel ist eine adressierte Ansprache lichtempfindlicher Zielstrukturen im Gewebe. In der Praxis bedeutet das: passende Wellenlängen, eine kontrollierte Intensität und ein zur Zielregion passender zeitlicher Verlauf der Impulse.
Weniger Hitze, mehr Biologie
Moderne Systeme verlassen sich nicht auf möglichst viel Wärme. Sie setzen auf eine Balance aus Energieabgabe und biologischer Aufnahmefähigkeit. Das Licht adressiert Photorezeptoren in Zellen. Diese können Prozesse wie Energieproduktion, Mikrozirkulation und Gewebestoffwechsel unterstützen.
Individuelle Anwendung statt Einheitslicht
- Programme und Intensitäten können an Empfindlichkeit und Zielregion angepasst werden
- Anwendungsdauer lässt sich je nach Gewebe und Tagesform variieren
- Fokus auf Verträglichkeit und reproduzierbare Abläufe
Das Ergebnis ist eine Anwendung, die praktischer und gezielter ist als pauschale Wärmeabgabe.
Fazit
Rotlicht hat einen festen Platz für oberflächliche Wärme. Wer tieferliegende Strukturen erreichen oder biologische Prozesse adressieren möchte, profitiert von moderner Infrarot-Technologie. Kombinationen aus Rotlicht und NIR sowie eine durchdachte Modulation erlauben es, die Wirkungstiefe und die biologische Antwort gezielter zu steuern.
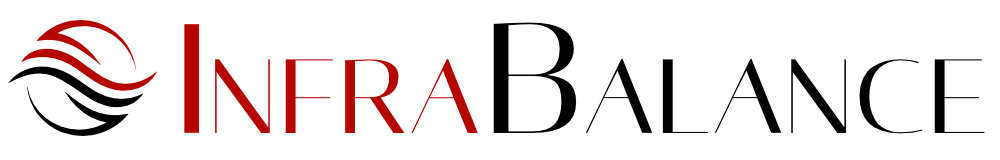

Share:
Faszien und Mikrozirkulation – die wahren Schmerzursachen?
Erfahrungsnahe Perspektiven zu ergänzenden Anwendungen