Expertenanalyse
LED‑Lichttherapie bei Schmerzen: was die Forschung sagt, Zhang et al., 2022
Narrative Übersichtsarbeit zu LED‑basierter Photobiomodulation: Schmerzreduktion, Sicherheit und mögliche Wirkmechanismen
Kurzfassung
Die Autorengruppe fasst zusammen, wie LED‑basierte Lichttherapie (Photobiomodulation) bei unterschiedlichen Schmerzformen eingesetzt wurde und welche biologischen Prozesse dabei eine Rolle spielen könnten. Betont werden insbesondere die gute Verträglichkeit und einfache Anwendbarkeit. Die Arbeit ordnet Ergebnisse zu Schmerzwerten ein und diskutiert Mechanismen, zum Beispiel entzündungsbezogene Signalwege, ohne konkrete Behandlungsprotokolle vorzugeben.
Worum geht es?
LED‑Lichttherapie nutzt nicht‑ionisierendes Licht (meist rot oder nahes Infrarot), um körpereigene Prozesse zu beeinflussen, ohne das Gewebe zu erhitzen. Die Übersichtsarbeit stellt zusammen, in welchen Schmerzbereichen LED‑Anwendungen untersucht wurden, und erklärt mögliche Hintergründe der Wirkung.
- Motivation: Schmerz wird oft mit Medikamenten oder invasiven Verfahren behandelt – diese haben Grenzen. LED‑Therapie wird als ergänzender, gut verträglicher Ansatz diskutiert.
- Schwerpunkt: Überblick über Effekte auf Schmerzen sowie eine verständliche Einordnung möglicher physikochemischer und neurobiologischer Mechanismen, besonders bei entzündungsbedingten Schmerzen.
- Sicherheit & Handhabung: LEDs gelten als kostengünstig und sicher; konkrete Risiken und Kontraindikationen müssen dennoch fachlich geprüft werden.
Das Wichtigste für Anwender
- Hinweise auf Schmerzlinderung: In mehreren Untersuchungen wurden niedrigere Schmerzwerte berichtet, teils begleitend zu Bewegung oder Standardtherapien.
- Mechanismen verständlich: Diskutiert werden u. a. Einflüsse auf Entzündungsmediatoren und neuronale Schmerzverarbeitung – das hilft, Effekte plausibel einzuordnen.
- Ergänzung, kein Ersatz: LED‑Lichttherapie wird als zusätzlicher Baustein verstanden. Sie ersetzt keine medizinische Behandlung und sollte in ein Gesamttherapiekonzept eingebettet werden.
- Realistische Erwartungen: Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Indikation, Gerät und Vorgehen. Langzeitdaten sind nicht für alle Bereiche gesichert.
Was bedeutet das im Alltag?
Für Betroffene kann LED‑Lichttherapie helfen, Schmerzen zu lindern und Training/Bewegung zu erleichtern. Sinnvoll ist eine fachliche Einordnung: Welche Beschwerden liegen vor? Welche Ziele haben Priorität? Zusammen mit Übungen, Ergonomie oder Physiotherapie lässt sich ein alltagstauglicher Plan erstellen.
Wie verlässlich sind die Ergebnisse?
- Studientyp: narrative Übersichtsarbeit – keine formale systematische Review mit Meta‑Analyse.
- Heterogenität: Die zugrundeliegenden Einzelstudien unterscheiden sich in Zielgruppen, Geräten und Parametern. Direkte Vergleiche sind dadurch begrenzt.
- Fazit mit Augenmaß: Positive Signale, aber uneinheitliche Evidenz. Für klare Empfehlungen sind mehr hochwertige, standardisierte RCTs nötig.
Hinweis zu Parametern
Die Arbeit beschreibt keine einheitlichen Praxisprotokolle. Wirkung und Eindringtiefe hängen u. a. von Wellenlänge (z. B. rot oder nahes Infrarot), Energie pro Fläche, Sitzungsdauer, Applikationsfläche, Abstand und Anwendungshäufigkeit ab. Ohne Volltextdaten zu konkreten Studien lassen sich keine pauschalen Dosierungsempfehlungen ableiten.
Vollständige Quelle
- Zhang WW, Wang XY, Chu YX, Wang YQ. Light‑emitting diode phototherapy: pain relief and underlying mechanisms. Lasers in Medical Science. 2022;37(5):2343–2352. DOI: 10.1007/s10103-022-03540-0, PMID: 35404002.
Es werden ausschließlich DOI und PMID verlinkt.
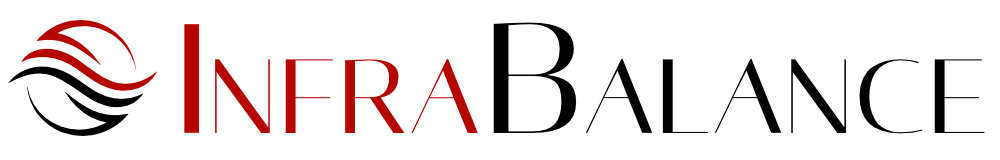

Share:
Schmerzreduktion bei muskuloskelettalen Beschwerden: Ergebnisse aus de Oliveira et al., 2022
Wissenschaftliche Zusammenfassung | Ergebnisse einer Studie zu lichtbasierten Schmerztherapien bei chronischem Rückenschmerz, Rubira et al., 2019